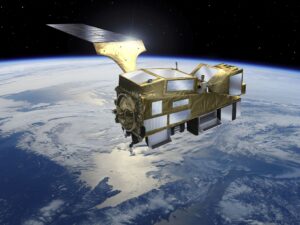Düsseldorf (dpa/lnw) – An mehreren Abwasserströmen von Chemiestandorten am Rhein ist industriell hergestelltes Mikroplastik festgestellt worden – an einer Stelle sogar in extremer Konzentration. Das geht aus einer Pilotstudie des Landesamts für Natur, Umwelt und Klima (Lanuk) hervor. Erstmals hatte das Lanuk direkt in den Abwassereinleitungen von Industriestandorten gezielt nach Industrie-Mikroplastikpartikeln gesucht.
Das Lanuk bezeichnete die Studie einschränkend als «Momentaufnahme» und erste Einschätzung. Weitere Untersuchungen sollen folgen. Erst mit einem stabileren Bild sollten Hochrechnungen zum jährlichen Beitrag der einzelnen Chemieunternehmen zur Belastung des Rheins möglich sein.
Mikroplastik in allen Proben
An allen vier untersuchten Abwassermessstellen wurden demnach Mikroplastikpartikel in Form sogenannter Beads oder Pellets gefunden. Die Spanne erstreckte sich von 0,95 bis zu 2.571 Beads pro Kubikmeter Wasser. Der Maximalbefund von 2.571 Partikeln liegt den Angaben zufolge weit oberhalb der anderen Befunde, die sich zwischen 0,95 und 18,9 Beads pro Kubikmeter bewegten.
Beads sind Kunststoffkügelchen, die vielen Kosmetik- und Körperpflegeprodukten beigemischt werden. In der EU sind die schwer abbaubaren Mikroperlen in vielen Bereichen bereits verboten.
Auch im Rhein selbst wurden an Wassermessstellen zwischen Bad Godesberg und Duisburg in allen neun vorgenommenen Proben Mikroplastikpartikel gefunden. Hier bewegten sich die Konzentrationen zwischen 0,6 bis 3,6 Partikeln pro Kubikmeter und nahmen tendenziell im Verlauf des Rheins von Süd nach Nord zu.
Beads- oder Pellet-Kunststoffkügelchen stellen allerdings nur einen Bruchteil der Mikroplastik-Belastung von Gewässern dar. Als Mikroplastik werden Kunststoffpartikel mit einem Durchmesser unter fünf Millimetern bezeichnet.
Es wird unterschieden zwischen primärem Mikroplastik – industriell hergestellten Partikeln wie Rohpellets und Beads – und sekundärem Mikroplastik. Letzteres entsteht durch den Zerfall größerer Kunststoffteile, etwa aufgrund von UV-Strahlung und vor allem durch Reifenabrieb. Auch synthetische Fasern aus Kleidungsstücken und Textilien zählen dazu.
Forschung steht noch am Anfang
Zwar waren auch schon in den vergangenen Jahren bei Untersuchungen etwa durch die Universität Basel und der Umweltschutzorganisation Greenpeace im Rhein erhöhte Mikroplastik-Konzentrationen festgestellt worden. Noch steht die Forschung und Analyse der Gefahren von Mikroplastik aber relativ am Anfang.
So müssten noch standardisierte Messverfahren für die verschiedenen Formen von Mikroplastik entwickelt werden, sagte Lanuk-Präsidentin Elke Reichert. Auch sei längst nicht alles über das Verhalten von Mikroplastik bekannt. Umso wichtiger sei es, dass der Eintrag in Gewässer schon an der Quelle im betrieblichen Alltag verhindert werde.
Die große Spannweite der Ergebnisse zeigt der Studie zufolge, dass Extremkonzentrationen von Chemiestandorten stammen können. Sie würden aber nicht generell in den Abläufen aller Betriebe gefunden. Ob es sich um kontinuierliche Einträge handele oder ob die Konzentrationen an den einzelnen Messstellen größeren Schwankungen unterliegen, soll durch weitere Proben ermittelt werden.
Die Industriestandorte wurden in der Studie anonymisiert. Es handele sich aber um bekannte und namhafte Chemieunternehmen in NRW, verriet NRW-Umweltminister Oliver Krischer (Grüne). Zusammen mit Reichert verschaffte er sich auf dem Laborschiff «Max Prüss» einen Eindruck davon, wie Proben im Rhein mit dem sogenannten «Manta-Trawl» genommen werden.
Grenzwerte sollen kommen
Langfristig sollen nach Angaben von Krischer Grenzwerte und Regeln für Mikroplastik in Gewässern entwickelt werden. «Denn Mikroplastik ist eine potenzielle Gefahr für unsere Gesundheit.» Jedoch müsse das Problem mit Industrie-Mikroplastik erst einmal eingeordnet werden, damit nicht am falschen Ende viele Aktivitäten eingeschränkt würden.
Krischer ging davon aus, dass es in ein bis zwei Jahren auf europäischer Ebene zumindest für einige Mikroplastik-Arten Orientierungswerte geben könnte.
Gesundheitsgefahren noch schwer abzuschätzen
Die Forschung zu den Gesundheitsgefahren von Mikroplastik steht nach Angaben der Lanuk-Biologin Maren Heß auch deswegen noch relativ am Anfang, weil es sehr unterschiedliche Kunststoffpartikel in verschiedensten Größen und Beschaffenheiten gebe. Die Testsysteme müssten dafür erst entwickelt werden. Es sei extrem komplex herauszufinden, welches Partikel wie auf den Organismus wirke.
«Von daher ist es sehr, sehr schwierig, eine allgemeingültige Aussage zu treffen», sagte Heß. Je kleiner das Plastikteilchen werde, desto mehr Barrieren könne es im Körper überwinden und umso potenziell gefährlicher könne es werden.
Plastik ist schwer abbaubar
Hinzu komme, dass Plastik schwer abbaubar sei. «Wenn das einmal in die Umwelt kommt, dann haben wir das für Jahrzehnte, Jahrhunderte liegen», sagte Heß. «Bis in die Arktis findet man Mikroplastik.» Der Rhein habe nach ihrer Einschätzung eine durchschnittliche Mikroplastik-Belastung für ein deutsches Fließgewässer.
Erste Konsequenzen wurden aus der Studie bereits gezogen. So wurden Gespräche mit Chemieunternehmen geführt, wie diese Plastikeinträge in das Rheinwasser vermindern könnten.
Bei der Begehung einzelner Betriebsbereiche sei bereits mit bloßem Auge festgestellt worden, dass sich dort Mikroplastikpartikel auf dem Boden befanden, sagte Krischer. Oft gelangten diese aus Versehen ins Wasser und würden nicht mit Absicht entsorgt. Verstärkte Reinigungsarbeiten sollen dies nun verhindern. Dass Mikroplastikpartikel in einem genehmigten Industrie-Prozess ins Abwasser gelangten, sei nicht illegal, solle aber beendet werden.