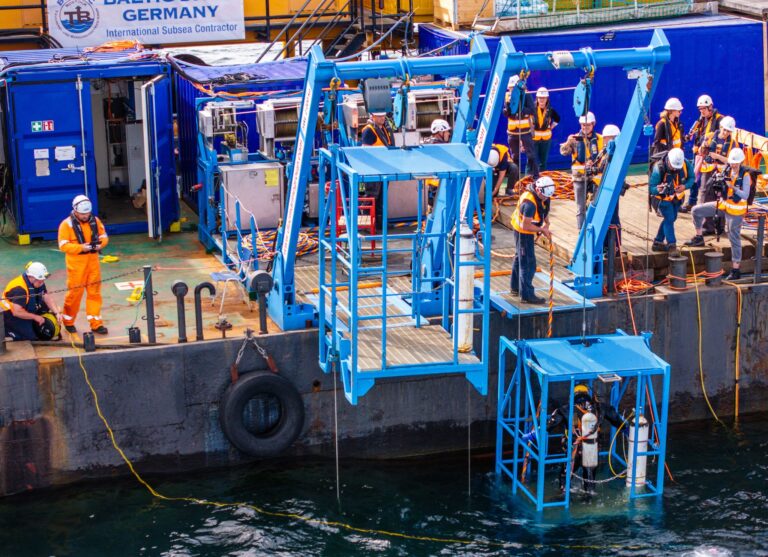Stuttgart/Berlin (dpa) – Die Atomkraft in Deutschland ist seit Mitte April passé. In Zukunft soll der Strom überwiegend aus erneuerbaren Energien erzeugt werden – etwa mit Photovoltaik-Anlagen auf Privathäusern. Zugleich werden in den kommenden Jahren Millionen Haushalte auf E-Autos und Wärmepumpen umsteigen. Die örtlichen Stromnetze sind darauf noch nicht ausgelegt. Um Engpässe zu verhindern, müssen sie flexibler werden – mit smarten Technologien. Wie das funktionieren kann, zeigt ein Beispiel aus dem Süden Baden-Württembergs.
Was ist das Problem?
E-Auto, Wärmepumpe, Photovoltaik-Anlage, eigener Energiespeicher – so sieht voraussichtlich der Haushalt der Zukunft aus. Bis 2030 wird es bis zu sechs Millionen dieser Anlagen im unteren Leistungsbereich geben. Damit rechnet Joachim Seifert, Professor für die digitale Vernetzung von Energiesystemen, an der Technischen Universität Berlin. «Für die Netzbetreiber wird das eine gewaltige Herausforderung.»
Das liegt hauptsächlich an den Niederspannungsnetzen – also dem Netz, das den Strom in die Haushalte bringt. «Dort sind die Engpässe: In den Trafos, in den letzten Schaltkästen und in den Leitungen, die in Straßen verlegt sind», sagt Seifert. Denn die Netze sind bislang hauptsächlich darauf ausgelegt, Energie von zentralen Kraftwerken zu Verbrauchern zu transportieren. In Zukunft kommen zahlreiche leistungsstarke Verbraucher wie Ladepunkte zuhause (Wallboxen) für E-Autos sowie Wärmepumpen hinzu. Zugleich werden viele Haushalte zu Stromerzeugern, die diese Energie auch ins Netz einspeisen wollen.
Und das kann die Netze an ihre Grenzen bringen?
Ja. Das Stichwort ist Gleichzeitigkeit. Zwei Beispiele: wenn an einem Winterabend in einem Wohnviertel alle Elektroautos gleichzeitig an der Steckdose hängen und die Wärmepumpen laufen. Oder wenn viele Photovoltaik-Anlagen an einem sonnigen Mittag gleichzeitig Strom erzeugen – und diesen einspeisen wollen. «Dann können die Netze an eine Kapazitätsgrenze kommen», sagt Seifert.
Im ersten Fall könnte das Netz nicht genug Energie bereitstellen, im zweiten den produzierten Strom nicht aufnehmen. Die Folge wäre in beiden Szenarien eine Überlastung. Die Transportkapazität des Netzes wäre erschöpft. Im schlimmsten Fall könnte das zu einem Stromausfall führen.
Wieso müssen die Netze «smart» werden?
Der Ausbau ist dringend notwendig – es fehlt aber an Zeit, Geld und Fachkräften. «Ohne Netzausbau geht es nicht. Wir wollen ja nicht permanent eingreifen müssen», sagt Carmen Exner vom Netzbetreiber Netze BW. Es fehle aber an den Ressourcen, um das Verteilnetz im benötigten Tempo ausbauen zu können. Da die Gefahr einer Überlastung im Moment noch sehr selten sei, sei das außerdem ineffizient. Lastspitzen entstünden nur zu bestimmten Zeiten. Es ergebe keinen Sinn, dafür das gesamte Netz überzudimensionieren.
An diesem Punkt kommen smarte Netze ins Spiel: Sie sollen die angeschlossenen Anlagen steuern können – um das Netz im Notfall zu entlasten. Exner zufolge soll mit ihnen außerdem die Zeit bis zum Netzausbau überbrückt werden: «Wir wollen alle Anlagen möglichst schnell ans Netz bringen. Wenn das aber erst in einigen Jahren möglich ist, brauchen wir intelligente Lösungen».
Wie funktioniert das genau?
Um das herauszufinden, hat Netze BW im südbadischen Freiamt einen 17 Monate dauernden Feldversuch unternommen. Dafür wurden 23 Haushalte ausgewählt, die etwa mit Photovoltaik-Anlagen und Wärmepumpen ausgestattet waren. Speicher, Wallboxen und Technik wie intelligente Stromzähler und Energiemanagement-Systeme wurden teils gestellt. So sei der Haushalt der Zukunft simuliert worden, sagt Projektleiterin Exner. Zudem wurden 24 größere PV-Anlagen in den Versuch eingebunden.
Die Versuche fanden im echten Netzbetrieb statt. Exner und ihrem Team gelang es, simulierte Engpässe auf zwei Arten zu verhindern: Bei akuten Überlastungen wurden automatisierte Befehle an die Haushalte verschickt, weniger Strom zu beziehen oder einzuspeisen. Mithilfe von Mess- und Wetterdaten konnten zum anderen auch Engpässe prognostiziert werden, die dann verhindert wurden.
In dem Beispiel würden die E-Autos anstatt abends erst in der Nacht laden. Und wenn der Wetterbericht einen sonnigen Tag ankündigt, könnten die PV-Anlagen am Mittag Lastspitzen vermeiden, indem sie den hauseigenen Speicher füllen statt ins Netz einzuspeisen.
Was heißt das für Verbraucherinnen und Verbraucher?
Im besten Fall sind die Folgen dieser sogenannten netzdienlichen Steuerung nicht oder kaum spürbar. Die Erfahrung aus dem Versuch zeigt: «Die meisten Kunden haben nicht gemerkt, ob ihre Wärmepumpe etwas früher oder etwas später läuft – solange das Wasser und die Wohnungen warm sind», sagt Exner. Die Akzeptanz sei hoch gewesen. Das gelte auch für E-Autos. Die Teilnehmer konnten beim Laden Präferenzen angeben – etwa, wann sie das Auto mit welchen Ladestand benötigen.
«Smarte Stromnetze ermöglichen den Netzbetreibern also, Überlastungen durch größere Handlungsspielräume zu verhindern – ohne dass unsere Kunden Nachteile haben», sagt Exner. Von den digitalen Netzen könnten Verbraucher künftig beispielsweise auch durch dynamische Strompreise profitieren – und ihr E-Auto dann laden, wenn besonders viel erneuerbarer Strom im vorhanden und entsprechend günstig ist.
Das Thema beschäftigt auch die Bundesregierung: Noch in diesem Jahr will die Ampel-Koalition ein neues Regelwerk vorlegen, wann und wie Netzbetreiber steuernd ins Netz eingreifen dürfen.
Wann gibt es das flächendeckend?
Zahlreiche Netzbetreiber haben dem Bundeswirtschaftsministerium zufolge Projekte zur Umsetzbarkeit von smarten Stromnetzen laufen. Das Projekt von Netze BW sei aber in der Demonstration des Zusammenspiels innovativ. Netze BW will die Ergebnisse als Blaupause für den eigenen Netzausbau nutzen – und anregen, etwa Schnittstellen der Anlagen zu vereinheitlichen.
Dies sei auch dringend nötig, da es noch unterschiedlichste Möglichkeiten gebe, wie man die Anlagen schalten könne, sagt Seifert von der TU Berlin. Das müsse bestenfalls europaweit in einem Standard vereinheitlich werden. Der Zeitraum bis zur Umsetzung intelligenter Stromnetze sei schwer abzuschätzen: «Die Energiebranche ist bei der Digitalisierung sehr konservativ. Bis alle Bereiche vom Gebäude bis hin zu den Niederspannungsnetzen digitale umfänglich erschlossen sind, vergehen sicher noch zehn Jahre».